
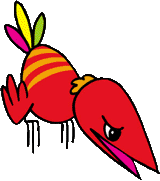

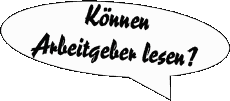
![]() Europäische Richtlinie 2003/88/EU vom 4. November 2003
zu bestimmten Aspekten der Arbeitszeitgestaltung
Europäische Richtlinie 2003/88/EU vom 4. November 2003
zu bestimmten Aspekten der Arbeitszeitgestaltung
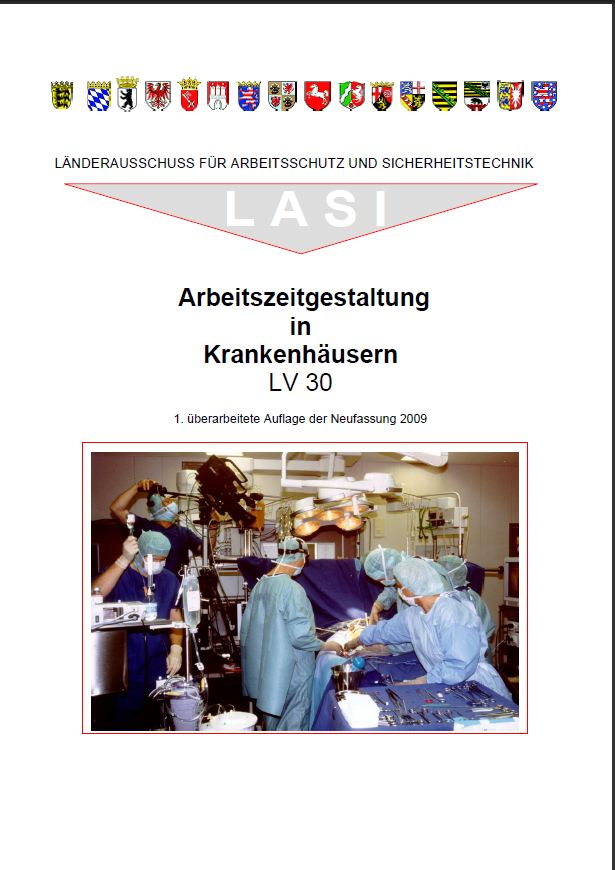 LV 30 des Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitsfragen (LASI); Juni 2012
LV 30 des Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitsfragen (LASI); Juni 2012
Arbeitszeitgestaltung in Krankenhäusern: Seite 20
»Wie ist Nacht- und Schichtarbeit zu gestalten?
Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer ist unter Berücksichtigung der gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu gestalten (siehe hierzu z. B. BAUA-Leitfaden zur Einführung und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit). Einige wichtige arbeitswissenschaftliche Kriterien zur Schichtplangestaltung sind:
• ungünstige Schichtfolgen vermeiden, Vorwärtswechsel der Schichten (Früh- / Spät- / Nachtschichten),
• Frühschichtbeginn nicht zu früh,
• keine Massierung von Arbeitszeiten; keine Arbeitsperiode von acht oder mehr Arbeitstagen,
• Regelmäßigkeit in der Schichtenfolge,
• regelmäßig freie Wochenenden,
• keine dauerhafte Nachtschicht,
• Begrenzung der Anzahl aufeinander folgender Nachtschichten, in der Regel nicht mehr als zwei bis vier Nachschichten in Folge,
• im Anschluss an die Nachtarbeit eine möglichst lange Ruhephase (möglichst 24 Stunden) anschließen.«

»
• Gewährleisten Sie die Mindestwochenruhezeit (35 Stunden = Sonntag bzw. Ersatzruhetag + 11 Stunden). […]
•Begrenzen Sie die Häufigkeit der Anordnung bzw. der Inanspruchnahme von Rufbereitschaft oder erweiterter Erreichbarkeit. […]
•Gewähren Sie rechtzeitig einen Ersatzruhetag. […]
• Verhindern Sie eine Folge von mehr als sieben Arbeitstagen, aber überschreiten Sie auf keinen Fall max. zwölf Arbeitstage.
• Sichern Sie eine angemessene Personalbesetzung und vermeiden Sie nach Möglichkeit Alleinarbeit.
• Prüfen Sie die angemessene Verteilung auf Ihre Beschäftigten.
• Dokumentieren Sie die gesamte Arbeitszeit am Sonn oder Feiertag. […]
Nacht und Schichtarbeit
[…] Folgende Aspekte sollten Sie genauer betrachten:
• Prüfen Sie die Verringerungsmöglichkeit von Nachtarbeit.
• Beachten Sie betrieblich relevante, gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zur Schichtplangestaltung (z. B.Vorwärtsrotation, kurzrollierendes Schichtsystem).
• Berücksichtigen Sie Beschäftigtenwünsche angemessen.
• Stellen Sie die Planbarkeit und rechtzeitige Bekanntgabe sicher.
• Nehmen Sie eine detaillierte Ausfallplanung (Personal, Maschine, Lieferung etc.) vor. Regeln Sie dabei, aus welchen Schichten in andere gesprungen werden kann, und berücksichtigen Sie unbedingt die Länge der Ruhezeit.[…]«
• Verlängern Sie die Arbeitszeit im Falle von Arbeitsbereitschaft nur, wenn die inaktive Zeit einen erheblichen Anteil der Gesamtarbeitszeit beträgt, also mindestens 30 Prozent. In der inaktiven Zeit muss Entspannung möglich sein.
• Verlängern Sie die Arbeitszeit im Falle von Bereitschaftsdienst nur, wenn die inaktive Zeit einen erheblichen Anteil der Bereitschaftsdienstzeit beträgt, also mindestens 50 %, insbesondere zu Beginn des Bereitschaftsdienstes.
• Planen Sie eine Ruhezeitverkürzung im Falle von Rufbereitschaft richtig (nicht in die Rufbereitschaft hineinarbeiten; nicht regelhaft in Anspruch nehmen; ausreichend Tage ohne Rufbereitschaft planen; keine Anrechnung als Ersatzruhetag).«
»Aufgrund der gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse ergeben sich zum Schutz der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgende Empfehlungen zur Gestaltung der Nacht- und
Schichtarbeit:
• kurze Nachtschichtfolgen von in der Regel nicht mehr als zwei bis vier Nachtschichten in Folge,
• die Vermeidung von Arbeitsperioden von mehr als
7 Arbeitstagen in Folge,
• die Vorwärtsrotation bei kontinuierlichen Schichtbetrieben (auf eine Frühschicht, folgt zunächst
eine Spät- und erst danach eine Nachtschicht),
• ausreichende Ruhezeiten zwischen zwei Schichten und regelmäßig freie Wochenenden in
kontinuierlichen Schichtsystemen,
• Wochenendfreizeiten, die mindestens zwei Tage und davon einen Samstag oder Sonntag
umfassen,
• Ausgleich der Mehrbelastung durch zusätzliche Freizeit,
• Anpaßung der Schichtlänge an den Grad der körperlichen und geistigen Beanspruchung durch
die Arbeit,
• kürzere Arbeitszeit in der Nacht als bei Früh- und Spätschichten (bei Nachtarbeit mit geringerer
Belastung kann die Nachtschicht allerdings auch verlängert werden, wenn dadurch weniger
Nachtschichten anfallen),
• möglichst später Beginn von Frühschichten und frühes Ende von Nachtschichten (bei
unumgänglicher kontinuierlicher Produktion oder im Dienstleistungsbereich sollen möglichst
gesundheitsgerechte Einzelfalllösungen getroffen werden),
• Flexibilität bei den Übergabezeiten, z. B. durch den Einsatz von Springern,
• Berücksichtigung individueller Arbeitszeitwünsche anstelle starrer Arbeitszeiten,
• Regelmäßigkeit in der Schichtenfolge, keine geteilten Schichten und rechtzeitige Information der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen über den Schichtplan.«
![]() Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse im Sinne von § 6 Arbeitszeitgesetz (Nacht- und Schichtarbeit); Internet-Auftritt zu Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen (Ministerium für Arbeits, Integration und Soziales des Landes NRW):
Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse im Sinne von § 6 Arbeitszeitgesetz (Nacht- und Schichtarbeit); Internet-Auftritt zu Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen (Ministerium für Arbeits, Integration und Soziales des Landes NRW):
• kurze Nachtschichtfolgen von in der Regel nicht mehr als zwei bis vier Nachtschichten in Folge,
• die Vermeidung von Arbeitsperioden von mehr als 7 Arbeitstagen in Folge und
• die Vorwärtsrotation bei kontinuierlichen Schichtbetrieben (auf eine Frühschicht, folgt zunächst eine Spät- und erst danach eine Nachtschicht).
Arbeitswissenschaftlich empfohlen werden darüber hinaus
• ausreichende Ruhezeiten zwischen zwei Schichten und regelmäßig freie Wochenenden in kontinuierlichen Schichtsystemen,
• Wochenendfreizeiten, die mindestens zwei Tage und davon einen Samstag oder Sonntag umfassen,
• Ausgleich der Mehrbelastung durch zusätzliche Freizeit,
• Anpassung der Schichtlänge an den Grad der körperlichen und geistigen Beanspruchung durch die Arbeit,
• kürzere Arbeitszeit in der Nacht als bei Früh- und Spätschichten (bei Nachtarbeit mit geringerer Belastung kann die Nachtschicht allerdings auch verlängert werden, wenn dadurch weniger Nachtschichten anfallen),
• möglichst später Beginn von Frühschichten und frühes Ende von Nachtschichten (bei unumgänglicher kontinuierlicher Produktion oder im Dienstleistungsbereich sollen möglichst gesundheitsgerechte Einzelfalllösungen getroffen werden),
• Flexibilität bei den Übergabezeiten, z. B. durch den Einsatz von Springern
• Berücksichtigung individueller Arbeitszeitwünsche anstelle starrer Arbeitszeiten,
• Regelmäßigkeit in der Schichtenfolge und
• besonders wichtig: rechtzeitige Information der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen über den Schichtplan
Eine ähnliche ![]() Übersicht über den Stand stellt die Bezirksregierung Arnsberg bereit oder etwa die
Übersicht über den Stand stellt die Bezirksregierung Arnsberg bereit oder etwa die ![]() Übersicht der Bezirksregierung Detmold.
Übersicht der Bezirksregierung Detmold.
![]() Broschüren zum Download u.a. Schrift „Schichtarbeit und Nachtarbeit”, Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung. München 1997, Autoren: Peter Knauth, F. Hornberger
Broschüren zum Download u.a. Schrift „Schichtarbeit und Nachtarbeit”, Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung. München 1997, Autoren: Peter Knauth, F. Hornberger
![]() Arbeitswissenschaftliche Kriterien der Schichtplangestaltung; Peter Knauth in: Das flexible Unternehmen
Arbeitswissenschaftliche Kriterien der Schichtplangestaltung; Peter Knauth in: Das flexible Unternehmen
Die Bundesanstalt stellt auf ihrer ![]() Webseite zusammen:
Webseite zusammen:
Ausgehend von vorliegenden arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen lassen sich folgende Handlungsempfehlungen formulieren:
1. Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Nachtschichten sollte möglichst gering sein
2. Nach einer Nachtschichtphase sollte eine möglichst lange Ruhephase folgen. Sie sollte auf keinen Fall weniger als 24 Stunden betragen.
3. Geblockte Wochenendfreizeiten sind besser als einzelne freie Tage am Wochenende.
4. Schichtarbeitende sollten möglichst mehr freie Tage im Jahr haben als Tagarbeitende.
5. Ungünstige Schichtfolgen sollten vermieden werden, das heißt immer vorwärts rotieren.
6. Die Frühschicht sollte nicht zu früh beginnen.
7. Die Nachtschicht sollte möglichst früh enden.
8. Zugunsten individueller Vorlieben sollte auf starre Anfangszeiten verzichtet werden.
9. Die Massierung von Arbeitstagen oder Arbeitszeiten auf einen Tag sollte begrenzt werden.
10. Schichtpläne sollen vorhersagbar und überschaubar sein.”
In der Broschüre ![]() Gute Stationsorganisation. Ein Leitfaden für Pflegeteams in Kliniken BAuA-Praxis, 1. Auflage. Dortmund: Februar 2024, 78 Seiten, finden wir auf Seite 41:
Gute Stationsorganisation. Ein Leitfaden für Pflegeteams in Kliniken BAuA-Praxis, 1. Auflage. Dortmund: Februar 2024, 78 Seiten, finden wir auf Seite 41:

Ohne Nacht- und Schichtarbeit funktioniert keine Klinik. Dienstpläne sollten so gestaltet werden, dass sie möglichst keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Sozialleben der Beschäftigten haben. Hierzu gibt es arbeitswissenschaftliche Empfehlungen.
Die Beteiligung von Beschäftigten an der Dienstplangestaltung wirkt sich positiv auf
deren Arbeitsmotivation aus! Wunscharbeitszeiten und gestaffelte Anfangszeiten verbessern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Dienstpläne sollten mindestens vier Wochen im Voraus bekannt gegeben und vonseiten des Klinikums auch eingehalten werden. Nur wenn Schichtpläne vorhersehbar
sind, können die Pflegenden Privates zuverlässig planen. Das erhöht Arbeitszufriedenheit wie auch Motivation und senkt Fehlzeiten.
Notwendige Dienstplanänderungen sollten mit einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens vier Tagen erfolgen.
12-Stunden-Schichten für beruflich Pflegende sind zu vermeiden, da andernfalls unerwünschte Folgen – etwa Müdigkeit durch Schlafentzug oder verringertes Konzentrationsvermögen – auftreten können. Dies kann auch die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gefährden.
Nach Möglichkeit sollten Schichten immer vorwärts rotieren. Die Schichtpläne sollten also so gestaltet sein, dass erst Frühschichten, dann Spät- und Nachtschichten aufeinander folgen. Schichtpläne, die entgegen dem Uhrzeigersinn rotieren, verstärken Schlafstörungen, erhöhen die Unfallgefahr und verringern die Zufriedenheit der Beschäftigten.
Auch bei vorwärts rotierenden Schichten sind schnelle Schichtwechsel zu bevorzugen. Das bedeutet, dass beruflich Pflegende maximal zwei bis drei Tage für die gleiche Schicht eingeteilt sein sollten. Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Nachtschichten sollte möglichst klein sein. Hier gilt: besser nur zwei aufeinanderfolgende Nachtschichten als drei. Bei mehr aufeinanderfolgenden Nachtschichten beginnt der Körper, seinen Tag-Nacht-Rhythmus umzustellen. Für eine Rückgewöhnung zum ursprünglichen Rhythmus wird dann mehr Zeit benötigt und Schlafdefizite werden angehäuft.
Die Frühschicht sollte nicht vor 6.00 Uhr beginnen, also keine »Fast-Nachtschicht« sein. Beginnt eine Schicht um 5.00 Uhr, klingelt mancher Wecker – je nach Anfahrtsweg – schon um 3.30 Uhr. Die Folge sind Schlafdefizite, Übermüdung und ein höheres Unfall- und Fehlerrisiko.
Eine Nachtschicht sollte nicht zu spät enden. Der Tagschlaf nach einer Nachtschicht ist umso länger, je früher man ins Bett kommt. Nach einer Nachtschichtphase sollten mindestens 24 Stunden Freizeit folgen.
Der Erholungswert von zwei zusammenhängenden freien Tagen ist höher als der einzelner freier Tage. Dabei sind zwei zusammenhängende freie Tage am Wochenende erholsamer als während der Woche. Ein freier Abend zwischen Montag und Freitag pro Woche ist für jede in der Pflege arbeitende Person empfehlenswert, da Freizeit während der Abendstunden erholsamer ist als zu anderen Zeiten in der Woche.”
Weitere ![]() Arbeitmaterialien.
Arbeitmaterialien.

Beschäftigte sollten möglichst nur freiwillig zu atypischen Zeiten arbeiten müssen.
Je mehr Personen die Arbeitszeiten am frühen Morgen oder späten Abend, in der Nacht und an Wochenenden flexibel unter sich aufteilen können, desto besser ist dies zu verkraften.
Atypische Arbeitszeiten sollten nicht zur Regel werden.
• Pausen in Absprache mit den Vorgesetzten in die Arbeitszeit einplanen, am besten regelmäßig kurze.
• Die eigene Leistungskurve beachten.
• Bewusst entspannen und Zeit zur Erholung nehmen.
• Arbeitsplatz während der Pause möglichst verlassen und Kontakte pflegen.
• Am besten, wenn möglich, sind Pausen bei Tageslicht im Freien.
• Ausgleich zur Tätigkeit schaffen – Bewegung bei Arbeiten im Sitzen, Ausruhen bei körperlich anspruchsvollen Aufgaben.
• Die Pausen von Kolleginnen und Kollegen respektieren und sich gegenseitig unterstützen.
Wo Nacht- und Schichtarbeit unverzichtbar sind, lassen sich gesundheitliche Risiken durch eine gute Organisation reduzieren:
• Schichtabfolge immer vorwärts rotierend.
• Chronische Müdigkeit bedingt durch rückwärts aufeinanderfolgende Schichten vermeiden.
• Kurze Schichtwechsel. Insbesondere nicht mehr als zwei bis drei Nachtschichten aufeinander folgen lassen.
• Dauernachtschicht und Wochenendarbeit vermeiden.
• Freizeiten im Block, nicht als einzelne Tage gewähren.
• Vorhersehbare und überschaubare Schichtplanung sicherstellen und kurzfristige Veränderungen vermeiden.
• Dauer der Schichten acht Stunden nicht überschreiten lassen.
• Mindestens 48 arbeitsfreie Stunden nach einem Schichtblock oder einer Nachtschichtphase einräumen.
• Beginn der Frühschicht einschließlich Anfahrtsweg zur Arbeitsstätte nicht vor 6 Uhr. Die Spätschicht sollte nicht nach 22 Uhr enden.
• Biologische Desynchronisation, beispielsweise durch Licht, geringhalten.
• Berücksichtigung des individuellen Chronotyps. So gibt es Morgentypen (sog. »Lerchen«), Abendtypen (sog. »Eulen«) und Mischtypen.
• Teilhabe am sozialen Leben bestmöglich gewährleisten.
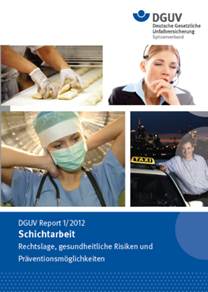 (auf Seite 134)
(auf Seite 134)„Zwingend ausgeschlossen sind Schichtfolgen, bei denen die vorgegebenen Ruhezeiten nicht eingehalten werden (können) — die Schichtfolge ‘Nacht-Früh’ ist also nicht zulässig.
Bei den Schichtfolgen ‘Spät-Früh’ sowie ‘Nacht-Spät’ kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an — generell gelten diese Schichtfolgen zumindest als ungünstig.
Folgende Gestaltungsmerkmale sollten im Allgemeinen beachtet werden:
1. Es sollte nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Nachtschichten geben.
2. Wenn Rotation, dann sollten Schichten vorwärts rotieren.
3. Es sollten nicht mehr als fünf Schichten aufeinander folgen, um eine Massierung der Arbeitszeit zu vermeiden.
4. Die Freizeiten sollten im Block genommen werden, nicht als einzelne Tage.
5. Die Ruhezeiten zwischen zwei Schichten sollten ausreichend sein (mindestens elf Stunden).”
Berufsgenossenschaft Hamburg: ![]() Forumsbericht Dr. Heike Scharborski:
Forumsbericht Dr. Heike Scharborski:
„Arbeitswissenschaftliche Empfehlungen an die Gestaltung von Schichtarbeit sind daher […]
• Freiwilligkeit bei der Schichtwahl ist günstiger, da derjenige, der selbst den Schichttyp wählt, ihn in der Regel besser „verträgt”
• klar definierte Pausen und ausgewiesene Pausenräume auch in der Nacht; Möglichkeit schaffen, warm zu essen beziehungsweise sich Essen aufzuwärmen und dieses in Gemeinschaft einzunehmen […]
• Personen über 50 Jahren sollten wegen der verlängerten Regenerationszeiten nicht im Nachtdienst eingesetzt werden, bei Schichtarbeit muss auf ausreichende Erholungszeiten zwischen den Diensten geachtet werden
• Beteiligung der Mitarbeiter bei der Gestaltung von Dienstplänen und der Veränderung von Arbeitszeitmodellen”
DGAUM (Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin) ![]() Leitlinie Gesundheitliche Aspekte und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit Version 2020 (ab Seite 136):
Leitlinie Gesundheitliche Aspekte und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit Version 2020 (ab Seite 136):

Aufeinanderfolgende Schichten
• Max. drei Nachtschichten in Folge
• Ungünstige Schichtfolgen (z.B. Nachtschicht / frei / Frühschicht oder Nachtschicht / frei / Nachtschicht oder einzelne Arbeitstage zwischen freien Tagen) vermeiden.
Rotationsrichtung
• Vorwärtsrotation der Schichten (d.h. Früh- Spät- Nachtschicht)
Geschwindigkeit der Rotation
• Schnelle Rotation von Früh- und Spätschichten (d.h. Wechsel alle 2 -3 Tage)
Schichtzeiten
• Frühschichtbeginn nicht zu früh (d.h. 06:30 ist besser als 06:00, 06:00 besser als 05:00 usw.)
(Einzel-)Schichtdauer
Keine Massierung von Arbeitszeiten. Mehr als 8-stündige tägliche Arbeitszeiten sind nur dann akzeptabel, wenn
• die Arbeitsinhalte und die Arbeitsbelastungen eine länger dauernde Schichtzeit zulassen,
• ausreichende Pausen vorhanden sind,
• das Schichtsystem so angelegt ist, dass eine zusätzliche Ermüdungsanhäufung vermieden werden kann,
• die Personalstärke zur Abdeckung von Fehlzeiten ausreicht,
• keine Überstunden hinzugefügt werden,
• die Einwirkung gesundheitsgefährdender Arbeitsstoffe begrenzt ist,
• eine vollständige Erholung nach der Arbeitszeit möglich ist.
Freie Zeit
• Geblockte Wochenendfreizeiten, d.h. mindestens Samstag und Sonntag frei und einmal im Schichtzyklus Freitag bis Sonntag oder Samstag bis Montag frei.
• Ein freier Abend an mindestens einem Wochentag (Montag bis Freitag).
Flexibilität der Beschäftigten
• Kurzfristige Schichtplanänderungen durch Arbeitgeber vermeiden.
• Mitarbeiterorientierte Flexibilisierung und Individualisierung der Arbeitszeit.
• Einflussnahme auf die Arbeitszeit, z.B. Wahlarbeitszeiten, Wahlmodule, individualisierte Dienstpläne (Notabene: Gespräche mit den Beschäftigten)
• Freiwilligkeit bei der Aufnahme von Nachtarbeit
• Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung ohne Nachtarbeit aus individuellen gesundheitlichen Gründen
Chronotyp-assoziierte Schichtplangestaltung
• Die Studienlage erscheint noch nicht ausreichend belastbar, um Arbeitszeiten nach Chronotypen zu empfehlen. Einzelne Studien (Vetter et al. 2015) geben jedoch Anhaltspunkte, dass eine Orientierung an Chronotypen zu einer Verlängerung der Schlaflänge führen kann.
Gesetzliche Grundlagen der Schichtplangestaltung
• Siehe – Arbeitszeitgesetz – Jugendarbeitsschutzgesetz – Mutterschutzgesetz

❍ Schichtplan-Fibel extra
Überstunden einschränken mit der Schichtplan-Fibel
 27.05. – 29.05.2026 im BiZ Gladenbach
27.05. – 29.05.2026 im BiZ Gladenbach
Wie die Beschäftigten vor Übergriffen auf die Freizeit geschützt werden können
Die Bedeutung von Freizeit nimmt zu. Für die Kolleginnen und Kollegen genauso wie auch für deren Arbeitgeber. Für eine verlässliche Lebensplanung braucht es Schichtpläne, die – rechtzeitig angeordnet – die vertraglichen Ansprüche und die Wünsche widerspiegeln. Die Wirklichkeit aber sieht anders aus: Die eingeplanten Pausen werden je nach Arbeitsanfall verschoben oder widerrufen; das Schichtende verrutscht früher oder später; alle paar Tage folgen neue Angebote für Planänderungen und Schichtwechsel.
Anhand kleiner Fallbeispiele untersuchen wir, wie die betriebliche Interessenvertretung die Kolleginnen und Kollegen vor Übergriffen auf ihre Freizeit schützen kann. Und wir diskutieren, inwiefern ´intelligente Ausfallkonzepte´ ent- oder belasten.
⊗ Verbindlichkeit der Schichtpläne: Für Arbeitgeber, die betriebliche Interessenvertretung, die Beschäftigten
⊗ Planergänzungen: Mehrarbeit und Überstunden
⊗ Planänderungen: Schichtwechsel, Arbeit an planfreien Tagen
⊗ Ankündigungsfristen, Zeit- und Gruppendruck
⊗ Gesundheitliche und soziale Folgen der Übergriffe
⊗ Erhöhte Schutzwirkung durch betriebliche Vereinbarungen
⊗ Zwangsmaßnahmen gegen gesetz- und vertragswidrige Übergriffe
Referent: Tobias Michel
❍ Schichtplan-Fibel extra
Pausen als Hebel zur Entlastung
 28.09. – 30.09.2026 im Biz Saalfeld
28.09. – 30.09.2026 im Biz Saalfeld
Pausen verlängern in jedem Fall die betriebliche Anwesenheit der Beschäftigten, ihre Erholungswirkung aber ist in vielen Fällen fraglich. Häufig werden Pausen im Tagesabauf eingeschoben, wenn das Arbeitsaufkommen es gerade zulässt. Insbesondere in den schlecht besetzten Schichten, am Wochenende, nachts oder im Bereitschaftsdienst verzichten Beschäftigte bereitwillig auf ihre Pausen.
Deshalb empfielt die Arbeitswissenschaft Arbeitgebern, geregelte Pausen zu organisieren. Das aber fällt vielen von ihnen aus vielerlei Gründen schwer. Also kümmert sich die Interessenvertretung besser selbst darum. Anhand von Fallbeispielen und Regelungsvorschlägen untersuchen wir, unter welchen Umständen Pausen für die Kolleginnen und Kollegen eine stärkende, entlastende Wirkung entfalten und erarbeiten uns Wege, bessere Pausenregeln durchzusetzen.
⊗ Gesetzliche Pflichten der Arbeitgeber
⊗ Arbeitswissenschaftlicher Stand zur Erholungswirkung (Kurzpausen mit begrenzter Wirkung)
⊗ Lage und Länge der Pausen
⊗ Pausenräume als soziale Kristallisationspunkte
⊗ Bezahlte Pausen, Pausen als Arbeitszeit
⊗ Mindestbesetzungen und Dokumentationspflichten des Arbeitgebers
⊗ Mitbestimmung der Pausen in den einzelnen Dienstplänen
Referent: Tobias Michel
❍ Schichtplan-Fibel extra – Bildungstage 2025
Konferenz zur Umsetzung der aktuellen Rechtsprechung in die betriebliche Schichtplanung
 17. – 19.12.2025 Biz Walsrode
17. – 19.12.2025 Biz Walsrode
Wir ordnen jüngste praxisrelevante Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und der Landesarbeitsgerichte Ihren betrieblichen Alltagssituationen zu. Die grobe Analyse des betrieblichen Alltags im Licht der entsprechenden Urteile führt unweigerlich zu konkreten Handlungsoptionen der Interessenvertretung. So entsteht eine beachtliche Sammlung alltagstauglicher Lösungsvorschläge rund um Regelungsgegenstände der Arbeitszeit, welche die Durchsetzung geltender Bestimmungen wesentlich erleichtert.
⊗ Überblick: Arbeitszeitverteilung zum Schutz vor Überlastung
⊗ Gesundheitsschutz und Entlastung
⊗ Teilzeit entlasten, ohne andere zu belasten
⊗ Mitbestimmen als Daueraufgabe
⊗ Aktuelle Rechtsprechung
⊗ Betriebliche Interessenvertretung außerhalb der Arbeitszeit
⊗ Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung
Referent: Tobias Michel
Die Gewerkschaft ver.di handelt in Tarifverträgen zur Arbeitszeit Kompromisse aus. Diese Formulierungen werden oft missverstanden als Indizien für Zumutbarkeit oder Angemessenheit. Ihre Tarifpolitische Grundsatzabteilung hat darum Anstöße zur Arbeitszeit formuliert. Tarifverträge und betriebliche Vereinbarungen sollen sie umsetzen. So auch zu -
Schichtarbeit
• Schichtarbeit vermeiden hat Vorrang. Schicht- und Nachtarbeit muss wegen ihrer gesundheitsschädlichen Auswirkungen die Ausnahme bleiben.
Hinweis: Im Interesse der Beschäftigtengruppen, die nicht bereits durch besondere Regelungen geschützt sind, sollte immer geprüft werden, inwieweit Schicht- und Nachtarbeit vermieden werden kann.
• Schichtarbeit ist nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen in Kombination mit zusätzlichen Entlastungsmaßnahmen in Abhängigkeit von den Anforderungsprofilen der jeweiligen Tätigkeit auszurichten (siehe auch nachfolgende konkretere Gestaltungsbeispiele).
• Die Arbeitsorganisation ist so zu gestalten, dass weniger Betroffene in Nachtschicht arbeiten müssen (Grundlage Arbeitsschutzgesetz).
• Nachtarbeit ist die Arbeit von … bis … Uhr.
Hinweis: Die gesetzliche Regelung (23 bis 6 Uhr) sollte dabei zu Gunsten der Beschäftigten großzügiger ausgelegt werden. Jede Arbeit in den späten Abendstunden oder nachts entzieht den Beschäftigten soziale Zeiten oder Ruhezeiten.
• Schichtarbeit ist so zu gestalten, dass ein bis zwei hintereinander liegende Nachtschichten, maximal drei Nachtschichten in Folge geplant sind.
Hinweis: Einzelne stattfindende Nachtschichten sind der Gesundheit zuträglicher, da sich Schlafdefizite kaum entwickeln können.
• Einer Nachtschichtphase sollten möglichst lange Ruhephasen folgen, mindestens 24 Stunden, besser jedoch zwei Tage.
Hinweis: Der Organismus braucht diese Zeit, um sich nach den Strapazen der Nachtarbeit vollständig zu regenerieren.
• Die Nachtschicht auf 5 bis 6 Stunden täglich bei vollem Lohnausgleich zu verkürzen, trägt dazu bei, Überanstrengung zu verringern und Erholungszeit auszudehnen.
• Schichtpläne sind der Gesundheit zuträglich zu gestalten. Der Schichtwechsel sollte vorwärts rollieren: Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht – frei – Frühschicht.
Hinweis: Diese Gestaltung entspricht dem natürlichen Rhythmus des Körpers. Der Tag wird verlängert. Die freie Zeit zwischen den Schichten bei Schichtwechsel verlängert sich.
• Schichtpläne sollten eine verkürzte Zyklusdauer abbilden. Ein schneller Wechsel, auch bei Früh- und Spätschicht ist sinnvoll (z. B. 2 Früh – 2 Spät – 3 Nacht – frei oder 2 Früh – 2 Spät – 2 Nacht – frei).
Hinweis: Die Anzahl der Frühschichten sollte ebenfalls drei in Folge nicht überschreiten, da der Schlaf vor Frühschichten meist recht kurz ist und dadurch auch zu Schlafdefiziten beitragen kann. Diese Defizite hängen nicht mit mangelnder Bereitschaft der Betroffenen zusammen, früher schlafen zu gehen, sondern mit individuellen Zeiträumen, in denen es schwerer oder leichter fällt, einzuschlafen.
• Bei kontinuierlicher Schichtarbeit ist den Beschäftigten möglichst oft ein freies Wochenende mit zwei zusammenhängenden freien Tagen zu ermöglichen. Fällt ein freier Tag auf das Wochenende, sollte dieser mit einem weiteren freien Tag verknüpft werde, z. B. Freitag bis Sonntag, Freitag und Samstag, Samstag und Sonntag oder Sonntag und Montag.
Hinweis: Damit kann die Isolation von familiärer bzw. sozialer Umgebung vermieden werden.
• In der Zeit von Montag bis Freitag ist mindestens ein freier Abend zu gewährleisten, um gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie verbringen zu können.
• Schichtarbeiter/innen sollten kürzer arbeiten als Beschäftigte in Normalschichten (mit Lohnausgleich oder z. B. durch Umwandlung der Zuschläge in Freischichten). Zwischen zwei Schichten sollte eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden (Ausnahmeregelung des ArbZG von 10 Stunden sollte vermieden werden) liegen.
Hinweis: Eine Massierung von Arbeitszeit sowohl täglich als auch wöchentlich führt zu überdurchschnittlicher Ermüdung.
• Beschäftigte im Schichtdienst haben ab dem vollendeten …(55) Lebensjahr aufgrund ihres erhöhten Regenerationsbedarfes Anspruch auf … Entlastungstage pro Monat//Quartal/Jahr.
Hinweis: Im Demografie-TV von ver.di und VHH ist eine Staffelung im Alter und konkreten Freistellungszeiträume geregelt. Bei Regelungen, die nur einzelne Beschäftigten erfassen, ist eine konkrete Begründung festzuhalten, damit der sachliche Grund (AGG) erkennbar wird.
• Überstunden sollten besonders in der Nachtarbeit eine absolute Ausnahme sein. Sie können zu überforderung und überbeanspruchung führen.
• Eine Verschiebung des Beginns der Schichtzeiten von 06:00,14:00 und 22:00 Uhr auf 08:00, 16:00 und 24:00 Uhr kann zu physiologischen und sozialen Vorteilen führen.
Hinweis: Jede Schicht erlaubt eine Mahlzeit im Familienkreis, für Früh- und Spätdienst werden bessere Voraussetzungen geschaffen, Schlaf zu finden, Störungen mit Schlafrhythmen anderer Familienmitglieder werden gemindert. Der spätere Beginn der Nachtschicht ist günstiger, da das physiologische Leistungstief (zwischen 2 und 4 Uhr) in der ersten Schichthälfte liegt und dadurch die Leistungsfähigkeit nicht schon durch übermäßige Ermüdung aufgrund bereits getaner Arbeit herabgesetzt ist. Der Abend kann noch mit der Familie verbracht werden und am Morgen die Einschlafphase zu einer Zeit erfolgen, in der Familienmitglieder oder Nachbarn das Haus bereits verlassen haben.
• Schichtpläne könnten flexible Beginn- und Endzeiten erhalten. Damit könnten unterschiedliche Belastbarkeit der Beschäftigten, ihr eigener Typ („Lerche“ oder „Eule“) und individuelle Zeitanforderungen (öffnungszeiten der Kindereinrichtung, Anfahrtswege, Pflegeaufgaben) berücksichtigt werden.
• Eine Reduzierung von Grenzwerten für gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe bzw. störende und schädliche Umgebungseinflüsse (z. B. Lärm, Kälte, Hitze) sollte über das arbeitswissenschaftlich festgelegte Maß hinaus erreicht werden. Angesichts der Zunahme von Stressoren und der damit verbundenen Beanspruchung, sind in dem Bereich tätige Menschen besonders anfällig, da das Immunsystem bereits angekratzt ist. Dies gilt im Besonderen in Bereichen, in denen Mehrarbeit geleistet wird. Ist dies nicht möglich, sollte die Arbeitszeit mit Lohnausgleich reduziert werden.
• Die Gestaltung bzw. die Veränderung von Schichtarbeit und Schichtplänen ist in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu entwickeln und vor einer dauerhaften Umsetzung in einem befristeten Zeitraum zu erproben und nachzusteuern.
Link und Lesezeichen: ![]() www.leitlinien.schichtplanfibel.de
www.leitlinien.schichtplanfibel.de